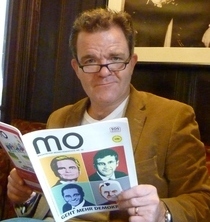Die Polizei als Nadelöhr
Sollte die Polizei gegen sich selbst ermitteln? Die Regierung hat bis Herbst ein Konzept für eine Ermittlungsstelle gegen Polizeigewalt in Auftrag gegeben. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Text: Gunnar Landsgesell
Klima-Demo, ein Sitzstreik von „Fridays for Future“ am 31. Mai 2019 in Wien. Die Bilder gingen auch durch die deutschen Medien. Ein junger Mann wird von zwei Polizisten am Boden fixiert, sein Kopf liegt unter einem Polizeibus. Als der Wagen losfährt, reißen die Beamten ihn im letzten Moment hoch. Der deutsche Staatsbürger, Anselm Schindler, hat mit seinem Anwalt Clemens Lahner Maßnahmenbeschwerde beim LPD Wien eingelegt – und Recht bekommen. Lahner dazu: „Die Polizei hat meinen Mandanten angezeigt, weil er nicht weggegangen ist. Die Amtshandlung hat ihn aber gar nicht betroffen, weil er nicht Teil der Demonstration war, sondern das Geschehen vom Gehsteig als Journalist verfolgt hat.“ Die Behauptung, Schindler hätte sich gewehrt, sei falsch. „Mein Mandant hat weder mit den Armen herumgefuchtelt, noch hat er sich widersetzt. Wir haben Maßnahmenbeschwerde erhoben gegen die Festnahme; dagegen, dass sein Kopf unter dem Auto war; und dass ihm eine Beratung durch den Rechtsanwalt verweigert wurde. Er wurde wegen einer angeblichen Verwaltungsübertretung 14 Stunden lang eingesperrt.“ Das Ergebnis: Die Amtshandlung war rechtswidrig. Und Lahner weiter: „Ein nächstes Verfahren wird es gegen den Polizisten geben, der die Festnahme durchgeführt hat, gegen einen zweiten Polizisten, der geholfen hat, und gegen den dritten, der den VW-Bus gelenkt hat. Ermittelt wird wegen Körperverletzung. Und ich gehe davon aus, dass auch wegen falscher Aussage ermittelt wird.“ Soweit der aktuelle Stand in dieser Causa. Maßgeblich für den Prozessverlauf war auch, dass jemand die Amtshandlung mitgefilmt hat. Auch in einem weiteren Vorfall bei der Klima-Demo (neun Schläge in die Nieren) wurde die Aussage eines Polizisten durch ein Handyvideo widerlegt. Eigentlich ein gutes Zeichen. Der Rechtsstaat funktioniert, auch wenn Einzelfälle wie diese das Vertrauen in die Polizei nicht unbedingt fördern.


Die Frage stellt sich zudem, wie das bei Polizeieinsätzen ist, bei denen niemand das Handy draufhält. Wie stehen dann die Chancen, gehört zu werden? Vor zwei Jahren untersuchte das an der Uni Wien angesiedelte Austrian Center for Law Enforcement Sciences (ALES) in einer Studie 1.500 Fälle in Wien und Salzburg, in denen der Polizei Misshandlung vorgeworfen wurde. Das Ergebnis: Nur sieben der 1.500 Fälle schafften es vor Gericht, in Salzburg wurden sämtliche Verfahren schon vorher eingestellt. Zu einer Verurteilung kam es in keinem einzigen Fall. Dass das doch eher überraschend ist, möchte Christian Grafl, Ko-Autor der Studie, nicht kommentieren. Das komme ganz auf die Erwartungshaltung an, so der Kriminologe. Grafl: „Wir haben sechs Interviews mit Staatsanwälten und der Polizei geführt und keinerlei Anzeichen dafür gefunden, dass sich Justiz und Polizei decken oder dass Polizisten in Verfahren mehr Glaubwürdigkeit besitzen. Das hätten wir in unserer Studie publiziert.“
Bleibt dennoch die Frage, warum solche Anzeigen kaum je vor Gericht landen. Der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak sieht ein grundsätzliches Problem darin, dass die Polizei bei solchen Gewaltvorwürfen gegen sich selbst ermittelt. Nowak: „Das Hauptproblem ist, dass innerhalb von 48 Stunden ermittelt werden muss und der Fall danach sofort an die Staatsanwaltschaft geht. Praktisch bedeutet das, dass jemand zur Polizei kommt und sagt, er ist misshandelt worden. Dabei weiß der Beschwerdeführer aber oft nicht, wer der Polizist ist, weil es in Österreich keine Namensschilder gibt. Die Aussage wird protokolliert, danach sind 48 Stunden Zeit, um den betreffenden Polizisten einzuvernehmen. Angenommen, man findet diesen, dann macht auch der Polizist eine Aussage. Zu einer direkten Gegenüberstellung kommt es aber nicht. So steht Aussage gegen Aussage.“ Auch Zeugen würden in dieser kurzen Zeit nicht einvernommen, auch sie müsste man erst ausfindig machen.
Falls es also kein Video gibt, geht der Akt in dieser Form an die Staatsanwaltschaft. „Was soll man dort aber tun? Die Staatsanwälte lassen den Akt erst einmal liegen, weil sie mit der mangelhaften Information keine Anklage erheben können. In den meisten Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft danach nicht weiter. Außer der Fall kommt über die Medien an die Öffentlichkeit“, so Nowak. Dass die Polizei nicht die beste Ermittlungsinstanz gegen sich selbst ist, liegt für das jahrelange Mitglied des Menschenrechtsbeirats auf der Hand. Man könne vieles an den Abläufen ändern, aber die Polizei bleibe das Nadelöhr. Seit Jahren fordern Nowak sowie NGOs wie Amnesty International eine unabhängige Ermittlungsstelle, ausgestattet mit polizeilichen Befugnissen. Nun könnte Bewegung in die Diskussion kommen. Im türkis-grünen Regierungsprogramm bereits verankert, hat die Regierung, wie aus einer parlamentarischen Anfrage der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper hervorgeht, die Ausarbeitung eines Konzepts bis Herbst 2020 in Auftrag gegeben. Mit welchen ExpertInnen die Einrichtung besetzt wird und wie ihre Unabhängigkeit gewährleistet wird, gilt es zu klären.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo